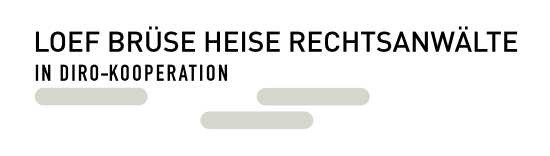Tattoos im Arbeitsleben – Ausdruck persönlicher Freiheit oder betriebliche Angelegenheit?
Immer häufiger sind Tattoos und Piercings im Arbeitsalltag sichtbar – quer durch alle Branchen und Hierarchieebenen. Die Frage, ob und wann Körperschmuck ausschließlich Privatsache bleibt oder doch das Arbeitsverhältnis berührt, gewinnt entsprechend an Relevanz. Unternehmen und Arbeitnehmende stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, Individualität und Unternehmensinteressen in Einklang zu bringen – mitunter auch vor rechtlichem Klärungsbedarf.
Gesetzlicher Rahmen: Individualrecht versus Unternehmerinteresse
1. Schutz des Persönlichkeitsrechts
Das Recht, über das eigene Aussehen zu bestimmen, beruht auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Tattoos und Piercings sind grundsätzlich Teil dieser durch das Grundgesetz geschützten Privatsphäre. Arbeitgeber dürfen Mitarbeitenden daher nicht generell vorschreiben, ob und wie sie sich körperlich modifizieren lassen.
2. Vertragsfreiheit, aber Diskriminierungsverbot
Im Bewerbungsverfahren gilt die Vertragsfreiheit: Unternehmen entscheiden, wen sie einstellen. Es kann also sein, dass ein Arbeitgeber aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes den Arbeitsvertrag nicht abschließt. Arbeitgeber sind dabei an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gebunden – Diskriminierungen aufgrund etwa von Geschlecht oder Religion sind unzulässig. Körperschmuck wird dabei nur dann geschützt, wenn er Verbindung zu einem Diskriminierungsmerkmal aufweist. Z.B. wenn der Tätowierung ein religiöser Hintergrund zugrunde liegt. Das äußere Erscheinungsbild allein ist nicht vom AGG erfasst.
Relevanz von Tätowierungen im Arbeitsverhältnis
1. Typische Praxisfälle
Die rechtliche Dimension von Tattoos entfaltet sich insbesondere, wenn der Arbeitgeber ein bestimmtes Erscheinungsbild seiner Beschäftigten verlangt. Dies betrifft vorrangig Positionen mit regelmäßigem Kundenkontakt, repräsentative Tätigkeiten oder Rollen in besonders konservativen Branchen.
2. Direktionsrecht und seine Grenzen
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers (§ 106 GewO) befugt dazu, Anweisungen hinsichtlich der äußeren Erscheinung zu treffen. Dabei darf jedoch nicht pauschal ein Tattoo-Verbot ausgesprochen werden; entscheidend ist stets eine sorgsame Abwägung im Einzelfall. Als Kriterien heranzuziehen sind insbesondere:
- Motiv und Größe der Tätowierung
- Sichtbarkeit während der Arbeit
- Konkrete Tätigkeit und Branchenüblichkeit
- Mögliche Auswirkungen auf das Image des Unternehmens
Verlangt werden kann regelmäßig, auffällige, anstößige oder geschäftsschädigende Motive zu verdecken. Hier muss das Unternehmensinteresse mit dem Individualitätsinteresse abgewogen werden und deutlich überwiegen.
Sonderkonstellationen: Öffentlicher Dienst und Beamtenrecht
Im Staatsdienst, etwa bei Lehrerinnen und Lehrern oder der Polizei, bestehen erhöhte Anforderungen an die Verfassungstreue und Vorbildfunktion. Das äußere Erscheinungsbild dieser Personen muss mit demokratischen Werten in Einklang stehen. Besonders schwer wiegt die Verwendung verfassungsfeindlicher Motive – selbst wenn diese nicht offen gezeigt werden. Nach der Rechtsprechung (LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 11.05.2021 – 8 Sa 1655/20) kann dies ein Grund für die außerordentliche Kündigung sein, wenn die Eignung für den Beruf dann grundsätzlich in Frage steht. Entscheidend ist das dauerhafte Bekenntnis zum Motiv – nicht nur dessen Sichtbarkeit.
Handlungsspielräume
1. Transparente Regelungen in der Unternehmenspraxis
Wenn Arbeitgeber bestimmte Vorstellung des Erscheinungsbildes haben, hilft es, diese frühzeitig zu kommunizieren. Arbeitgeber können im Arbeitsvertrag oder durch Betriebsvereinbarung klare, sachlich begründete Regeln zum Erscheinungsbild vorsehen, um spätere Konflikte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sie sind dabei an das allgemeine arbeitsrechtliche Maß der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit gebunden. Ein generelles Tattoo-Verbot überschreitet in aller Regel diese Grenze und ist unwirksam.
2. Beteiligung des Betriebsrats
Regelungen zur äußeren Erscheinung unterliegen nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG der Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats, wenn ein solcher Betrieb vorhanden ist. Ohne dessen Einbindung sind allgemeine Vorgaben zu Kleidung und Aussehen im Betrieb unzulässig.
3. Sanktionsmöglichkeiten
Verstößt ein Arbeitnehmer gegen eine rechtmäßige Weisung zur äußeren Erscheinung, kommt zunächst eine Abmahnung in Betracht. Eine Kündigung ist nur nach wiederholten oder gravierenden Pflichtverletzungen und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zulässig. Nur bei schweren Loyalitätsverletzungen – etwa durch das Tragen eines verfassungswidrigen Tattoos – kann eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtlich vertretbar sein. Dabei kommt es genau auf den Einzelfall an.
Empfehlungen und Ausblick
Tattoos und Piercings sind im modernen Berufsalltag Teil der individuellen Entfaltung und grundsätzlich Privatsache. Zugleich ist die Rücksicht auf unternehmerische Belange in bestimmten Fällen rechtlich geboten und praktisch sinnvoll. Arbeitgeber sollten ihre Erwartungen schriftlich fixieren und transparent kommunizieren. Angestellten wird empfohlen, bei Unsicherheiten im Vorfeld die Zustimmung der Leitung einzuholen. Letztlich gilt: Entscheidend ist stets die sorgfältige Einzelfallbewertung unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien.
- Von Katharina Müller, Rechtsanwältin
dh&k Rechtsanwälte Steuerberater